.
Eine kurze Einführung in den Roman und ein Prolog
 Ein geheimnisvolles Päckchen, das an die falsche Person übergeben wird. Ein Offizier der Staatssicherheit, der eine Amour fou mit einem ehemaligen Model eingeht. Eine junge Frau in Leipzig, die in den inneren Kreis des Widerstands gegen das SED-Regime hinein wächst und dabei überwacht wird. Eine alleinerziehende Bankerin, die in Prag Geschäfte machen soll und nur ihre Affäre mit einem verheirateten Mann im Kopf hat…
Ein geheimnisvolles Päckchen, das an die falsche Person übergeben wird. Ein Offizier der Staatssicherheit, der eine Amour fou mit einem ehemaligen Model eingeht. Eine junge Frau in Leipzig, die in den inneren Kreis des Widerstands gegen das SED-Regime hinein wächst und dabei überwacht wird. Eine alleinerziehende Bankerin, die in Prag Geschäfte machen soll und nur ihre Affäre mit einem verheirateten Mann im Kopf hat…
Der etwa 700 Seiten starke Roman Reichstage ist weder Kriminal- noch Agentenroman. Er setzt im Vorfeld des Jahres 1989 ein und folgt den Ereignissen in der DDR wie auch ihrem Wiederhall in der BRD mit dem vorläufigen Schlusspunkt der Wiedervereinigungsnacht. Vor dem Hintergrund der Ereignisse, an deren Anfang der ungeklärte Tod einer jungen Frau steht, kreuzen sich – ausgelöst durch die irrtümliche Übergabe eines Päckchens - die Schicksale einer Handvoll Männer und Frauen in Ost und West.
Auch wenn die historischen Ereignisse den Hintergrund für die drei Handlungsstränge (Köln, Leipzig, Narff, eine Kleinstadt) bilden, steht doch das Schicksal der Figuren im Vordergrund: ihr Umgang mit Täuschung und Verrat, ihre Suche nach Liebe und Erfolg, Anerkennung und Glück.
‚Reichstage‘ ist, zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, der Versuch eines deutsch-deutschen Romans.
____________________________________________________________
[Berlin, 2. Oktober 1990]
Von all den Leuten, die Javier Escalon an diesem Tag vergeblich nach einem freien Zimmer fragen, wird sich der selbstbewusste Rezeptionist des Hotels Berlin Central noch Jahre danach allein an die Frau in dem eleganten Wildlederkostüm erinnern. Freilich nicht nur, weil sie ihm, auch nach der ersten Absage hartnäckig bleibend, einen Hundert-Mark-Schein über den spiegelnden Mahagonitresen zuschiebt, sodass er entschieden seine Hände in Abwehr heben und die unschuldig-weißen Handflächen vorzeigen muss.
„Bedaure, meine Dame! Wir könnten die Zimmer vier- oder fünfmal vermieten. Da geht leider gar nichts mehr...!"
Damit schiebt er den Schein sorgfältig zurück, auf dass es alle sehen, und wendet sich nun, nach einer angedeuteten Verbeugung, anderen Gästen zu. Darunter ein Mann, der einen breitkrempigen Hut trägt und bei ihm eincheckt.
„Tom Boeder sagen Sie? Ja. Eine Suite für zwei Personen. Hatten Sie eine gute Reise? Was für ein Tag! Sogar das Wetter spielt mit. Ich sehe, Sie sind allein? Oder erwarten Sie noch jemand?“
„Vermutlich erwarte ich niemand mehr.“
„Dann haben sie Ihre Suite ganz für sich allein... Sie ist sehr schön. Ein besonders breites Bett und ein luxuriöses Bad, Sie werden ja sehen… Sie sind also allein?“
Tom Boeder schiebt den Hut mit einer ungeduldigen Geste aus der Stirn und schaut den Rezeptionisten missmutig an. „Ist das verboten?“
„Nein, um Gottes Willen! Nein! Ich bin nur ein wenig erstaunt. Wissen Sie, seit die Wiedervereinigung beschlossene Sache ist, gibt es kein freies Hotelbett mehr in der Stadt. In ganz Berlin nicht...“
Javier Escalon zeigt erneut seine unschuldig-weißen Handflächen, um ein allgemeines Bedauern auszudrücken. Er ist ein gebürtiger Spanier, mit einem scharfkantigen, gutgeschnittenen Gesicht, kurzgehaltenem Spitzbart und merkwürdig kleinen Ohren. Er trägt eine dunkelblaue Hoteluniform, von der jedoch nur die geknöpfte Weste zu sehen ist. Die Frau in dem Wildlederkostüm steht immer noch am Ende der Rezeptionstheke, halb verdeckt durch eine lärmende Gruppe US-amerikanischer Fernsehleute.
„Könnte ich nicht das freie Bett im Zimmer dieses Herrn haben?"
Die Frage ist laut vorgetragen und klingt ganz unerschrocken. Sie bewirkt, dass der Rezeptionist irritiert zu der elegant gekleideten Dame und dann wieder zu Tom Boeder schaut, unsicher, ob das ernst gemeint sein kann. Doch der nimmt seine neue ledergefasste Reisetasche, tippt leicht mit dem Zeigefinger an den Hut und geht hinüber zu dem gläsernen Aufzug, der ihn ins fünfte Stockwerk hebt.
Rosalind van Achten. Tom hat ihre Stimme erkannt. Den kräftigen, selbstbewussten Ton, unterlegt von einem kaum wahrnehmbaren englischen Akzent. Und doch hat er nicht zu ihr hin geschaut. Er weiß, dass sie ihm folgen wird.
Ein Hotel, gelegen im Bezirk Tiergarten, ganz in der Nähe von Reichstag und Brandenburger Tor. 220 Zimmer und Suiten. Und das ist also das letzte Zimmer in Berlin, denkt Tom, nachdem er die Suite betreten hat: zwei große Aussichtsfenster, dämpfende Teppichböden und Vorhänge, ein breites, gut gepolstertes Bett mit einer Ansammlung von weichen Daunenkissen, ein luxuriöses Bad mit Dusche, Wanne und Bidet. Fernseher, Minibar, Föhn. Vierhundertdreißig für eine Nacht, ohne Frühstück.
Tom, der die anstrengende Bahnfahrt von Dresden auf den Gleiskörpern der DDR-Reichsbahn hinter sich hat, lässt sich erschöpft aufs Bett fallen. Am liebsten möchte er sich ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Warum habe ich mich darauf eingelassen? fragt er sich. Warum bin ich eigentlich hier?
Wiedervereinigung. Das bedeutet für ihn: Menschenmassen und glückliche Gesichter. Mit beidem kann er nichts anfangen. Jede Ansammlung von Menschen stößt ihn ab, als handle es sich um unbekannte Kraftfelder, von denen er schon weiß, dass sie nachteilige Wirkungen auf ihn haben werden. Ohnehin hat er keine Lust, das Hotel zu verlassen. Zugleich ist er jedoch zu unruhig, um allein zu bleiben, und so verstärkt die eigene Unentschlossenheit noch sein inneres Aufgewühlt sein.
Tom nimmt die Fernbedienung vom Nachttischchen und richtet sie auf den Fernseher, als wollte er seine Vorahnungen bestätigt sehen. Wohin er auch schaltet: auf allen Programmen kündigt sich die Wiedervereinigung an, Menschenmassen, glückliche Gesichter.
Etwas schwerfällig tappt er hinüber zu den beiden Fenstern. Sie sind nicht zu öffnen, weisen aber in Richtung Reichstag, der irgendwo nördlich liegt. Der Tag draußen erscheint noch merkwürdig ruhig, wie unter Watte, obwohl schon jetzt, am späten Vormittag, viele Menschen die Straßen in Richtung Brandenburger Tor passieren. Immer noch unruhig nimmt er wieder die Fernbedienung zur Hand. In einem der Programme sieht man eine große Tribüne, die erst in den letzten Tagen errichtet wurde. Er kann erkennen, wie dort Techniker in roten Overalls arbeiten, die letzten Vorbereitungen.
Nachdem Tom eine Weile hin und her überlegt hat, fährt er wieder hinunter in die hell erleuchtete Eingangshalle, wo ein unablässiges Kommen und Gehen herrscht. Rechts ist die langgestreckte Rezeption, links, hinter einer raumhohen Glasfront, eines der beiden Restaurants. Als ihm Essensgeruch entgegen schlägt, spürt er seinen Hunger. Seit dem Morgen hat er nichts gegessen. Doch als er nach einem Platz fragt, antwortet ihm der Ober entschieden, dass alle Tische belegt seien und zeigt zum Beweis in die weite, belebte Runde. Missbilligend mustert er den Hut, den Tom nicht abgesetzt hat.
„Sind Sie allein?“
Aber Tom ist hungrig genug, das zu verneinen. Für einen Einzelnen würde es zweifellos nichts geben. Also lässt er sich einen Tisch für vier Personen reservieren. Tom soll eine Stunde warten und setzt sich in die Halle, in einen der Lesesessel der Rezeption gegenüber, bestellt einen doppelten Espresso und blättert in den ausliegenden Tageszeitungen, die einmütig die Einheit Deutschlands für die Nacht auf den 3. Oktober ankündigen. Doch nimmt er die Schlagzeilen nur oberflächlich wahr. Sein Blick gleitet immer wieder hinüber zu den Menschen, die kommen und gehen, als wären sie an ein endloses Band gehängt. Auch hier sind zwei große Fernseher aufgebaut, der Wechsel der Bilder erkennbar am Wechsel der Helligkeit, ein Halbrund von Menschen, als suchten sie Licht.
Allmählich wird ihm klar, dass sich viele Journalisten im Hotel aufhalten, erkennbar an ihren Identitätskarten, lauten Stimmen und Taschen voller Ausrüstung. Ihre massenhafte Anwesenheit wirkt seltsam lächerlich auf ihn. Ein oder zwei Journalisten hätten zweifellos genügt für die Balkenüberschriften und die Fotos vom Reichstag, wie sie später durch die Zeitungen gehen werden. Tausend Reporter, die einige Dutzend Politiker, Künstler und Intellektuelle befragen… Bei der Vorstellung schüttelt Tom unwillig den Kopf. Warum fragt dich niemand nach Belle? denkt er. Warum ist in den Nachrichtensendungen so wenig die Rede von dem, was ich empfunden habe? Und warum sprechen die Leitartikel der Zeitungen nicht von meiner Liebe zu ihr?
Er lässt seinen Handrücken achtlos auf das Zeitungspapier fallen, es gibt einen scharfen Knall. Javier Escalon schaut von der Rezeption herüber, für einen Moment strafft sich seine Gestalt, die kleinen Augen kritisch verengt. Aber Tom merkt es nicht einmal. Er stellt sich die Schlagzeilen von Herald Tribune, Time Magazin, Le Monde vor, die von seiner Liebe zu Belle handeln. Und sie machen sich nicht schlecht. Unterhalb, an dritter oder vierter Stelle, bliebe noch Platz genug für die deutsche Einheit. Und dann sieht er sich auch in den Nachrichtensendungen der großen Sender, zur besten Sendezeit, verpackt zwischen feste Werbeblöcke, wie er sich nachlässig in einen breiten Ledersessel kauert, in der Halle eines Berliner Hotels mit mittelbarem Blick auf den Reichstag, den breitkrempigen braunen Hut mit dem umlaufenden silbergrauen Band hat er aus der Stirn geschoben, und einer dieser Reporter mit Westküstenakzent und Kaugummi in der Backentasche befragt ihn zu Belle. Und die Leute in Amerika, die eigentlich gerade zu einem Sender mit mehr Action zappen wollen, bleiben stehen, weil sie bewegt, was dieser Mann da erzählt.
Es hatte ein gewaltiges Medieninteresse gegeben, über mehrere Wochen hinweg. Belles Schönheit spielte dabei eine Rolle und natürlich der Umstand, dass sie ein Model gewesen war, mit einem gewissen Vorleben. Auch der alte Buchmann war noch eine politische Größe, an die man sich erinnerte. Die Polizei hatte sämtliche Personen in Belle Buchmanns Umfeld verhört. Man hatte die Ermittlungen bis Mailand und Paris ausgedehnt und selbst die ungarischen Behörden um Amtshilfe gebeten. Auch war es einer der ersten Fälle, bei dem die westdeutsche Justiz – gleichsam im Vorgriff auf die kommenden Verhältnisse – die Behörden in Ostberlin und Leipzig um Mitarbeit ersuchte. Doch bei den Vernehmungen und Nachforschungen kam nichts heraus, außer vielleicht Belles Vorliebe für Wagemut und ihre Probleme mit dem Gleichgewicht. Das Päckchen, von dem noch einmal die Rede war, blieb ebenso verschwunden wie das silberne Kettchen mit dem Davidstern, das sie zuletzt getragen hatte. Später sollten sich Zeugen melden, die Skinheads gesehen hatten, in der Nähe der Eisenbahnbrücke.
Als Tom nach einer Stunde das Restaurant erneut betritt, hält er den Hut in der Hand. Der Ober, dessen Gesicht südländische Züge hat und von Stress gezeichnet ist, zeigt auf einen Tisch, der gerade neu eingedeckt wird.
„Darf ich Ihnen den Hut abnehmen?“ fragt er und lässt ihn sich geben. „Vier Personen?"
Die Skepsis, ob es hier mit rechten Dingen zugeht, steht noch in seinem Gesicht, als sein ausgestreckter Arm schon den Weg zum Tisch weist.
„Vier… Ja sicher! Also, ich erwarte noch drei Damen…“, behauptet Tom. „Aber ich bestelle schon mal, wenn’s recht ist… Ich habe einfach Hunger. Was können Sie denn empfehlen? Diese verdammte Reichsbahn… Na ja, Sie wissen schon…“
Doch den Ober interessiert nicht, warum Tom hungrig ist. Unentwegt lässt er seine Blicke über die anderen Tische schweifen. Endlich verzieht er den Mund zu einem kühlen Lächeln, winkelt den linken Arm im Rücken an und leiert das Tagesmenü herunter. Drei Gänge, mit Suppe.
Tom schaut ebenfalls zu den anderen Tischen, die zumeist vollständig besetzt sind, bemerkt aber nichts Auffälliges, das ihn vom Menü abhalten könnte, und stimmt allem zu. Ohne die Suppe. Ihm steht jetzt der Sinn nach anderer Flüssigkeit. Kurz darauf wird schon das Amuse-gueule serviert, eine halbe Brotscheibe mit einem Stück gebratener Entenstopfleber. Er steckt den Happen ganz in den Mund, als könnte er damit seinen Hunger beweisen, und nippt dazu an seinem Aperitif, einem Glas Chablis, das für die Amerikaner an den umliegenden Tischen mit einem Eiswürfel serviert wird.
Als er gerade einen weiteren großen Schluck Chablis nimmt, um die Krümel wegzuspülen, geleitet der Ober Rosalind an seinen Tisch und schiebt ihr den Stuhl ihm gegenüber zu Recht.
„Nummer eins!“ sagt der Ober halblaut wie zu sich selbst und es klingt nicht unzufrieden.
Nach ihren Wünschen gefragt, antwortet Rosalind van Achten in einem Ton, der nach jahrelanger Vertrautheit klingt: "Ich nehme, was der Herr bestellt hat…!"
Zu dem auffälligen Wildlederkostüm trägt sie eine weiße Trachtenbluse mit malvenfarbener Stickerei, die sie konservativer aussehen lässt, als es zu der Situation passte. Dass sie hier ist, kann kein Zufall sein, denkt Tom. Was will sie also von ihm? Er ist kein wohlhabender Geschäftsmann. Kein Gigolo. Er hat nach wie vor ein paar Kilo zu viel. Die knochige Nase, die hohe Stirn und der mönchische Hinterkopf. Das ungesellige Wesen. Kein Journalist, die besseren Manieren, die ihm die Mutter eingetrichtert hat. Rätselhaft allein die Fingerkuppen, deren Linien grün eingefärbt sind.
Rosalind ordnet das vor ihr liegende Besteck neu, für eine Linkshänderin. Vor einem Jahr haben sie zusammen gegessen, einige Male. Er hat mit ihr geschlafen. Warum ist ihm das nie aufgefallen? Rosalind van Achten, mindestens vierzig Jahre alt, eher klein und nicht ganz schlank, mit rotblonden Haaren und grünen Augen, die Frau eines wohlhabenden Kölner Schmuckhändlers, in keiner Weise mit Belle vergleichbar, aber von englischem Geblüt.
„Warum bist du hier? Ich dachte, alles ist abgewickelt und geklärt. Ich habe das Päckchen nicht.“
„Nichts ist geklärt! Außerdem hast du das letzte freie Zimmer in der Nähe des Reichstags."
Dass es ihr nur um das Zimmer gehen könnte, ist so unwahrscheinlich, dass es ihn amüsiert.
„Warum grinst du?“
„Ich musste an einen französischen Film denken…“
„Isch liebe französische Filme!“ flötet sie. „Seit mehr als zwanzig Jahren. Aber was hast du damit zu tun?“
Tom erzählt ihr, dass in dem Film ein Berufskiller den Auftrag hat, General de Gaulle zu liquidieren, bei einer Militärparade in Paris, von einem Hotelzimmer aus.
„Willst du damit sagen, dass ich wie ein Berufskiller vorgehe?“
„Warum nicht?“
„Und wenn schon! Es gibt einen Film, da spielt Kathleen Turner einen Berufskiller in Diensten der amerikanischen Mafia. Also spricht nichts gegen diese Art von Gleichberechtigung.“
Sie lacht und ist dabei so laut, dass ihre kräftige Stimme im halben Restaurant zu hören ist. Obwohl sie nahezu akzentfrei deutsch spricht, klingt das Lachen angelsächsisch. Als ihr Amuse-gueule serviert wird, will sie es abweisen, bemerkt aber Toms gierigen Blick und lässt es ihm servieren. Wieder verspeist er es in einem Happen.
„Warum bist du in Berlin?" fragt er mit vollem Mund, als er ihren belustigten Blick bemerkt.
„Soll ich dir wirklich mein ganzes Leben erzählen?"
„Ich dachte, seit Budapest weiß ich alles über dich?“
Sie winkt ab, wieder mit einem Lachen. „Alles Lüge. Du kennst mich doch.“
Bald darauf wird mit der theatralisch-schwungvollen Geste, die auch an anderen Tischen zu beobachten war, der Hauptgang serviert. Dreierlei Pasta: Penne Rigate, Girandole, Fusilli, in den Nationalfarben eingefärbt mit Tintenfisch, Tomate, Safran, angerichtet wie eine vom Wind bewegte Fahne, deren krummen Mast gegrillte Scampi bilden. Der Ober empfiehlt dazu einen Weißwein aus der Toscana, aber die Engländerin ordert einen halbtrockenen Riesling aus dem Rheingau. Ein Glas? Nein, eine Flasche.
Rosalind schaut amüsiert auf ihren Teller. „Was machen wir mit so vielen Nationalfarben?“
„Essen!“ sagt Tom und mengt die Pasta einfach durcheinander.
Später wird als Nachspeise noch ein weiterer ‚nationaler Dialog’ gereicht: pürierte Früchte - Brombeere, Erdbeere, Birne - auf ausladenden Desserttellern malerisch ausgebreitet. Doch Tom verrührt auch seinen Fruchtbrei stoisch wie ein Kind die Farben einer Palette, während Rosalind ihm noch einmal erzählt, was er seit Budapest weiß: dass sie vor mehr als zwanzig Jahren in Berlin war, zum Höhepunkt der Studentenrevolte.
„Das wird heute eine Art Abschlussfeier für diese Jahre.“
Sie lächelt verhalten, um zu zeigen, dass sie sich zumindest selbst versteht.
„Aber du bist Engländerin! Das sind deutsche Farben. Das ist eine deutsche Abschlussfeier!“
„Wir Engländer hatten schon immer eine Schwäche für die Rheinromantik!“
„Wir sind in Berlin.“
„In Köln hat es angefangen, am Rhein.“
„Das war nicht romantisch.“
„Ich finde schon, dass es romantisch war!“ sagt sie mit einfühlsam gewordener Stimme. "Du trauerst noch um Belle, das verstehe ich. Weißt du, manchmal denke ich, sie war das perfekte Produkt ihrer selbst.“
Tom ahnt zwar, dass die Engländerin Recht hat. Dennoch sucht er entschieden nach einem Widerspruch. „Du kennst sie nicht wie ich“, sagt er schließlich. „Belle wollte immer auch etwas darüber hinaus sein."
.
 Eine Anfrage bezüglich der Möglichkeit, binnen kurzer Zeit 18 Nilpferdgedichte zu schreiben, ließ mich an eine Begegnung mit einem Experten für Nilpferdgedichte denken: Wjatscheslaw Kuprianow.
Eine Anfrage bezüglich der Möglichkeit, binnen kurzer Zeit 18 Nilpferdgedichte zu schreiben, ließ mich an eine Begegnung mit einem Experten für Nilpferdgedichte denken: Wjatscheslaw Kuprianow.  Slawa, wie er von den anderen Artists in residence genannt wurde, war ein freundlicher, umgänglicher Herr Ende fünfzig, zurückhaltend, aber auch sehr humorvoll. Er war damals gerade sehr erfolgreich - mit einem Lyrikband an der Spitze der SWF-Bestenliste und eingeladen zu einem Lyriker-Treffen nach Kanada. Dennoch merkte man ihm - in Gesprächen über die aktuelle Entwicklung in seiner Heimat - eine fundamentale Kränkung an, die ihm im Russland Gorbatschows widerfahren sein musste. Ich wusste, dass Slawa im kommunistischen Moskau zu den priviligierten Intellektuellen gehört hatte. Verheiratet mit einer Opernsängerin lebte er im Prominentenviertel, hielt sich aber in Distanz zum Regime.
Slawa, wie er von den anderen Artists in residence genannt wurde, war ein freundlicher, umgänglicher Herr Ende fünfzig, zurückhaltend, aber auch sehr humorvoll. Er war damals gerade sehr erfolgreich - mit einem Lyrikband an der Spitze der SWF-Bestenliste und eingeladen zu einem Lyriker-Treffen nach Kanada. Dennoch merkte man ihm - in Gesprächen über die aktuelle Entwicklung in seiner Heimat - eine fundamentale Kränkung an, die ihm im Russland Gorbatschows widerfahren sein musste. Ich wusste, dass Slawa im kommunistischen Moskau zu den priviligierten Intellektuellen gehört hatte. Verheiratet mit einer Opernsängerin lebte er im Prominentenviertel, hielt sich aber in Distanz zum Regime.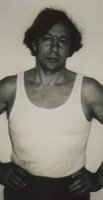
 Was mir in Erinnerung bleibt von
Was mir in Erinnerung bleibt von  Von Dezember 2000 bis Januar 2001 war ich auf Einladung des niederländisch-deutschen Kulturaustauschs in Amsterdam. Ich wohnte in einem kleinen Apartment unter dem Dach eines alten Patrizierhauses direkt am Vondelpark, im Südwesten der Stadt. In den vier Wochen meines Aufenthalts streifte ich jeden Tag durch die Straßen und an den Grachten entlang, um zu einzelnen Orten zu kommen, die mir lieb geworden waren - oder um neue zu entdecken. So war ich häufig im Grand Café De Jaren, um dort an den Zeitungstischen bei einer Tasse Kaffee ein wenig zu lesen, das bunte Gemisch von Touristen, Studenten (der nahen Hochschule) und 'normalen' Bürgern der Stadt zu beobachten und dann mein Tagespensum von zwei, drei Seiten zu schreiben. Durch die riesige Fensterfront hatte man einen ungehinderten Blick auf die Amstel, wichtiger für mich waren jedoch Ausblicke auf die großen und kleinen Inszenierungen von Individualität im Inneren des theatergroßen Raumes.
Von Dezember 2000 bis Januar 2001 war ich auf Einladung des niederländisch-deutschen Kulturaustauschs in Amsterdam. Ich wohnte in einem kleinen Apartment unter dem Dach eines alten Patrizierhauses direkt am Vondelpark, im Südwesten der Stadt. In den vier Wochen meines Aufenthalts streifte ich jeden Tag durch die Straßen und an den Grachten entlang, um zu einzelnen Orten zu kommen, die mir lieb geworden waren - oder um neue zu entdecken. So war ich häufig im Grand Café De Jaren, um dort an den Zeitungstischen bei einer Tasse Kaffee ein wenig zu lesen, das bunte Gemisch von Touristen, Studenten (der nahen Hochschule) und 'normalen' Bürgern der Stadt zu beobachten und dann mein Tagespensum von zwei, drei Seiten zu schreiben. Durch die riesige Fensterfront hatte man einen ungehinderten Blick auf die Amstel, wichtiger für mich waren jedoch Ausblicke auf die großen und kleinen Inszenierungen von Individualität im Inneren des theatergroßen Raumes. Ein geheimnisvolles Päckchen, das an die falsche Person übergeben wird. Ein Offizier der Staatssicherheit, der eine Amour fou mit einem ehemaligen Model eingeht. Eine junge Frau in Leipzig, die in den inneren Kreis des Widerstands gegen das SED-Regime hinein wächst und dabei überwacht wird. Eine alleinerziehende Bankerin, die in Prag Geschäfte machen soll und nur ihre Affäre mit einem verheirateten Mann im Kopf hat…
Ein geheimnisvolles Päckchen, das an die falsche Person übergeben wird. Ein Offizier der Staatssicherheit, der eine Amour fou mit einem ehemaligen Model eingeht. Eine junge Frau in Leipzig, die in den inneren Kreis des Widerstands gegen das SED-Regime hinein wächst und dabei überwacht wird. Eine alleinerziehende Bankerin, die in Prag Geschäfte machen soll und nur ihre Affäre mit einem verheirateten Mann im Kopf hat… 






































